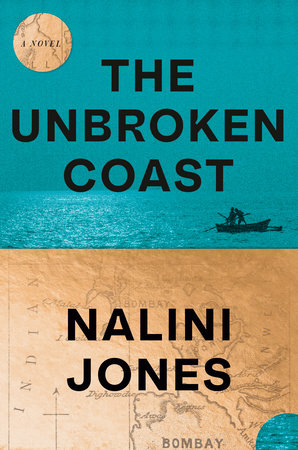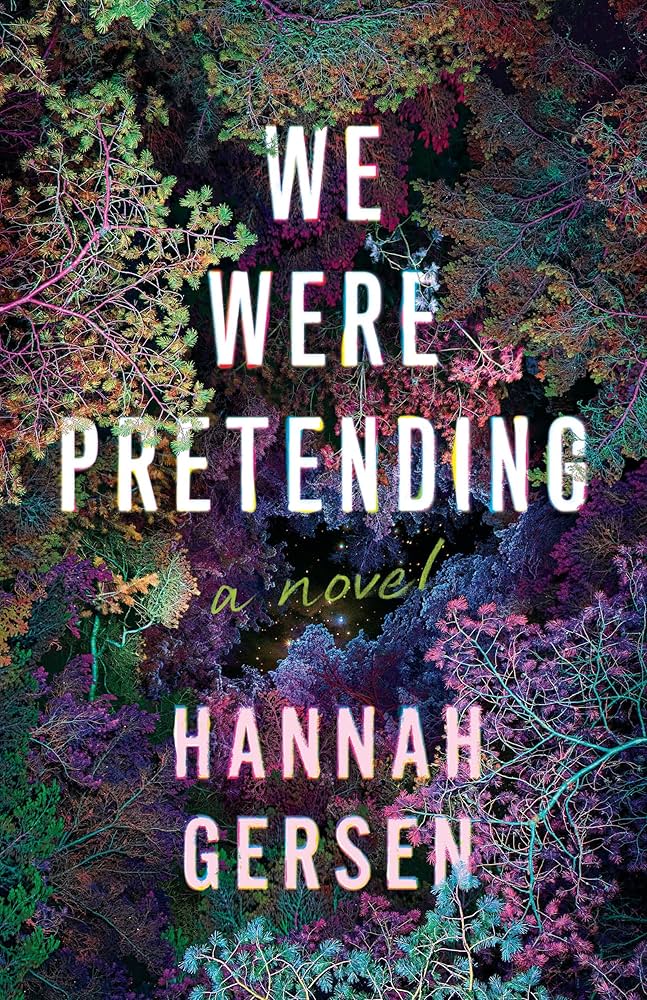By EMINE SEVGI ÖZDAMAR
Translated from the German by YANA ELLIS
Piece appears below in both English and German.
Translator’s note
One of the many things that drew me to A Space Bounded by Shadows is the novel’s overarching theme of exile and wandering between worlds — imaginary and real. The narrative weaves the rich tapestry of an artist’s life between art, relationships, and politics and their declaration of love for literature, film, and theatre. As an immigrant myself, the book captured me immediately because it explores how mother tongue and second language can merge, creating a new, enriched language and overcoming speechlessness in exile.
Özdamar’s work has an emotional immediacy, inviting the reader to participate in an intellectual and poetic dialogue between different languages and world views. The book moves seamlessly in the space of a few sentences from a mythical narrative style, in which passages are cyclically repeated and the walls and animals speak, into a direct historical style. The author lets motifs drip through French, Turkish, and German, and in doing so she opens ‘spaces of association.’ I was careful to retain that specific Özdamar sound—a mixture of sober documentation of events and magic.
In this excerpt, we arrive in Paris to the creaking tone of a question: what does it mean to be in the world with a visa that is only valid for weeks, to live in the always wandering bubble of the theatre world, sometimes to look for accommodation there? Throughout the book, in alignment with the phases of her life, the narrator asks herself: ‘Where do you live, Madame?’ and replies: ‘I live in a smile, in Besson, in Balzac.’ One time she answers that she lives in love or fear, sometimes in a Parisian coffee cup or in a phone book.
An interesting challenge was represented by the sentence: ‘Ich lebe in Besson, ich wohne in Besson.’ On the surface both verbs ‘leben’ and ‘wohnen’ can be interpreted as ‘to live’ in English. However, ‘leben’ is more general and it means ‘to exist;’ ‘wohnen’ is often used when it denotes residence and therefore means ‘to reside.’ So, following from this, my translation would be: ‘I live in Besson, I reside in Besson.’ However, just a few sentences later the narrator declares: ‘Ich wohne in einem Lächeln.’ Were I to follow the choice made earlier this line should be ‘I reside in a smile,’ which I disregarded as ‘reside’ to my ear disturbs the rhythm of the poetic lines. On the other hand, it reflects the impermanence of an emigrant’s life but it does not reflect the desire of the narrator to forge a re-birth in a new language. I retraced my steps and chose to render ‘Ich lebe in Besson, ich wohne in Besson’ as ‘I live in Besson, Besson is my home,’ which I felt incorporates the desire to anchor yourself.
***
PHONE BOX
Benno said, ‘Hallo, oui.’ ‘It’s me, Herr Besson.’ ‘Welcome to Paris! I’m happy you’re here. Come see me at 3 o’clock.’ I made a note of his address. Then I called Mari, my Armenian friend from drama school. She had left Istanbul with another friend, Diana, after the military coup. A man answered, ‘Alo, oui.’ ‘Mari?’ The man started talking in Turkish, ‘Mari doesn’t live in Paris anymore.’ ‘Oh, oh!’ ‘She met someone two months ago and left for Canada with him. I live here now.’ ‘Oh,’ I said, ‘she was my best friend in Istanbul. Oh, dear, have I come too late, oh, oh, oh, oh, oh?’ Then I went silent. The man on the phone went silent too. And eventually I said, ‘Ah, ah, ah.’
The man outside the phone box was waiting. He wobbled his head through the glass, smiled and held up his phone tokens ‘I need to go.’ The man on the phone said, ‘My name is Sinan. I live on the Boulevard Raspail, come by sometime then you can see where Mari lived.’
I came out of the phone box but loitered outside.
So, you moved to Canada then, Mari. No, that’s wrong. Someone, a person, moved her to Canada. She was in Paris, in a city, in France, in a country, but she ran after a person; just like me then when I first went to Berlin, to Germany, to Besson, to the great man of the theatre. Besson left Berlin and said, ‘Come with me, work with me in Paris’ and I left Berlin. So, Mari and I no longer had a country, but a person. The people we followed were our countries.
And what would happen if Besson died now? Then the country would be gone, the city would be gone, the Gare du Nord would no longer be your train station. Once you leave your own country, you never arrive in another. A few special people then become your country. Then the likes of us shouldn’t answer the question that we hear so often, ‘Where do you live; do you live in Germany; do you live in France?’ with ‘Yes, I live in France, yes, I live in Germany.’ The correct answer would be: ‘I live in Besson, Besson is my home.’ But you could never give this answer because no one would ever ask the right question: ‘Do you live in Besson, is Besson your home?’
And what happens if Besson is no longer there? Where do I live then, where is my country?
The man in the silk shirt with a missing button came out of the phone box, spoke in French, said a couple of times, ‘Occupé, occupé.’ Perhaps he meant the number was busy and I could use the phone now. Then he smiled again.
I live in a smile.
Good, my country is his smile.
Merci, Monsieur.
He left and went in the direction Gaspard and Maurice had taken. In the phone box I practised my first French word occupé — oküpe; wrote it down together with Mari’s address in my notebook. Then I went out but lingered in front of the phone box. A woman came up and stood before me with a questioning look. ‘Nümero oküpe,’ I said. She went into the phone box, phoned someone, came out and said in passing, ‘Madame!’ I went in again and without dropping a token in the slot, picked up the receiver, leant against the glass and started talking to myself.
Madamm doesn’t know where she’ll sleep tonight. Madamm has no money, Madamm has no country, only people. Madamm doesn’t need a residence permit for that, but when a policeman asks for her passport and looks at it, he will say, ‘But Madamm, where’s your residence permit? You’re living in Europe illegally; you’re here without papers; you must go back to your country. You’ve been living illegally in Europe for three years. You’re only allowed to stay for three months on a tourist visa. Where have you lived for the last three years, Madamm?’ ‘Berlin.’ ‘What did you do there?’ ‘Worked in the theatre.’ ‘And where is your residence permit?’ ‘I worked in East Berlin, the International Theatre Institute gave me papers for the time I was there, an art visa, an arts employee permit.’ ‘And where is this permit now?’ ‘They took it away from me at the border when I left.’ ‘Can you prove it?’ ‘I don’t know.’ ‘Where are you staying in Paris?’ ‘I don’t know—in the phone box?’ ‘Come with me!’ ‘No, I have to stay here in the phone box.’ ‘Why, Madamm?’ ‘Well, because foreigners like to make phone calls, and when they talk to their countries they shout into the receiver. Istanbul is far far away.’ ‘You are from Istanbul, Madamm?’ ‘Yes, from Istanbul.’ ‘Madamm, when you had your revolution with Atatürk against your Sultans, did you behead the Sultan?’ ‘No, we didn’t behead him.’ ‘You didn’t even throw him in prison, Madamm?’ ‘No, not even in prison. They boarded a ship and left Istanbul.’ ‘This is good, Madamm. You did well there. We, the French, beheaded our kings and queens. We’re traumatised, Madamm. Goodbye, Madamm.’
I think I must’ve held the receiver too tightly; my wrist hurt, and my travel bag was tired—it hung askew from my shoulder. I opened the Paris phone book, looked for Charis and Efterpi’s address and found it: Rue de la Glacière, 13e Arondissement, Paris.
EFTERPI DE LA GLACIÈRE
I went into a tall new house on Rue de la Glacière. The Spanish concierge led me along a dark corridor to the garden. The garden was big and, on the left, next to each other, were four identical studio apartments. The thick glass-walls facing the garden were also doors and slid sideways. Through the glass you could see inside the rooms. The concierge stood before the third studio and said, ‘Voilà Madame.’
As I stood in front of Efterpi’s glass door, in the hope of peeking inside, at first I saw only my wavering reflection and I couldn’t see through it. I approached the shadow until my nose touched the glass and I could no longer see the shadow, only then did the large high-ceilinged room become visible. A big table and chairs were at the front; there was a baguette on the table, breadcrumbs, a book—Georges Sadoul’s Dictionnaire des filmes, and a packet of cigarettes; behind the table at a right angle was a sofa, on the floor a pair of high-heeled green brogues; in the middle of the room were two coffee tables stacked with papers, books, and a typewriter. Behind them I could see a large bed covered with rugs and cushions, and beside it a fireplace. There was a flight of stairs to the left and the right wall was entirely taken up by shelves, endless rows of books and records peeping from their places into the shadowy room toward an animated silence. Just as you could see on the baguette and crumbs the hands of the people who had eaten them, so you could see on the books the hands that had opened them, read them, closed them, then put them back and taken them up again, looked inside, used them, closed them again; they stood in their places, some further in, others further out, some a little crookedly, as if their voices were murmuring, leaving an ever-present echo in this room. The light from the garden crept across the stone floor of this large room. The pictures on the walls, the books, the chair legs, the tables danced in the growing light; beside the baguette and breadcrumbs, on the long table behind the glass door, the birch tree’s shadow fell. Its silhouette quivered on the table; the leaves rustled in the gentle wind outside. I took hold of the birch tree and shook it—its silhouette quivered even faster.
Suddenly, a cat with bandy legs came down the stairs, crossed the shadow on the floor, walked towards me a little, jumped onto a chair facing the garden, sat on the plump cushion from which a few cat hairs were dispersed into the air and looked in my direction. That was Badi. Efterpi had sent her photo to me in Istanbul.
Efterpi and I knew each other from Istanbul. That was in the late 60s, before the second military coup. My other friend, who studied film with Pasolini and Fellini in Italy, started a cinema movement back then in Istanbul. We used to publish a magazine like Cahiers du cinéma where we analysed films by Godard, Buñuel, Pasolini, Glauber Rocha, Brecht, Ousmane Sembène, Dziga Vertov, Jean-Marie Straub, Eisenstein. My friend wanted to shoot a film about an insurgent during the time of the Ottoman Empire called Blindensohn; the little money he had was only enough for the film materials, so he needed people who were happy to work for free on the film. He soon gathered a crew. It was composed of four Turkish Greeks, a Turkish Jew and six Turks—among them big theatre names. Efterpi and Dido were Istanbul Greeks. Efterpi was married to Dido’s brother Charis, who was a professor of documentary cinematography at the university in Paris. Dido was the script girl. We needed someone who could create a blind-man’s mask for the film production, because the insurgent Blindensohn—the protagonist—had a father who was blinded with hot pokers on the orders of the wicked feudal landowner. Efterpi had studied for months as a make-up artist in Paris before coming to Istanbul and she did a great job of creating the mask for the actor who played the blind man.
My friend and I lived in a forest. When Efterpi came to Istanbul we all went walking in the woods. Efterpi was so beautiful that even the sheepdogs, who barked viciously every time a stranger walked past our woodland house, forgot to bark. As our party was strolling, Efterpi got lost somewhere in the woods. We shouted and searched for her. My friend laughed and said, ‘Parisian women like to get lost so someone can come to their rescue.’ I liked the way that the Parisiennes fancied themselves being searched for.
My friend had drawn, just like Eisenstein, all the scenes in the film. Scene by scene. On the first day everyone was happy, including the sun above us. We were shooting a scene in some stables. The insurgent Blindensohn had a fabled horse. My job was camera assistant, and I had the best female role—Blindensohn’s sweetheart. In the middle of the film my heroine was to be hung by her hair on a tree and killed. I had waist-length hair.
We first shot the scene with the arms dealers, arms dealers from Europe, who delivered weapons to the wicked feudal landowner so that he could kill Blindensohn. Then we filmed in the stables. A Romani had lent us his white horse, a gifted horse-actor which performed the role of Blindensohn’s horse. My friend showed the drawing of this scene to the lighting technician. The light in the scene was supposed to illuminate only a strip on the back of the horse and everything else was to remain in darkness, but that was not possible. The lighting technician called on the best-known technician in Istanbul—an elderly gentleman with dark glasses. The horse patiently waited in the stables. But the light that was supposed to illuminate only a long strip on his back was not to his liking either. A couple of hours went by. The light outside was slowly fading and the Romani said that he needed to get the horse back home. He and the horse left. Our Jewish colleague, Jacob, gave the famous lighting technician a lift to town; my friend, Efterpi, Dido and Yorgo took the film material we had already shot and went to Yorgo’s house in a taxi, forgetting all of the film cassettes in the taxi’s boot. I went with the cameraman to his studio in Istanbul’s red-light district to put away the Arriflex 35mm film camera. A few prostitutes greeted us and asked the cameraman what we had been filming today and the film’s name. He replied laughing, ‘AT IŞIĞI—Horse light’.
The film never materialised. The money ran out and soon after came the 1971 military coup; my friend’s Greek partner Yorgo fled to Athens because he was a Marxist and was afraid of the Turkish military. Efterpi returned to Paris. In a quiet alleyway in Istanbul, she encountered a cat with bandy legs; she took her to Paris and called her Badi—Bandy Legs.
I knocked on the glass, shouted, ‘Efterpi, Efterpi!’ and looked toward the stairs as if, just like Badi, she too would suddenly be standing there. Nothing stirred.
In the glass, somewhere behind me, in front of a high garden wall, I saw the reflection of a bench. I walked between the flowers and the trees and sat down on the bench. From there I could see through the glass doors of all four studios. I saw a cat in the studio next to Efterpi’s. It stood on a high landing like a statue and like Badi was looking into the garden. The garden was quiet; only the sound of a typewriter could be heard in the distance. They came from an apartment window of the high-rise building that overlooked the garden.
I lay down on the bench, shut my eyes, and thought about the train corridor between Berlin and Paris, the café on the Gare du Nord, Gaspard and Maurice, the phone box, the man with a missing shirt button, the garden bench. Eyes shut, I thought about the man’s missing shirt button in the phone box, the black receiver—somewhat soulless after so much use, the missing pages in the telephone directory, blind Gaspard’s yellow suede jacket with its high woollen collar.
Whilst I was lying on the bench with eyes shut, a bird flew back and forth above me, made a cheeping noise; settled on a tree or a bush and did another cheep.
Cheep.
Cheep.
Cheep.
Cheep.
Between the cheeps, I heard the mechanical noise of a heavy door opening: Efterpi was just pushing her glass door from right to left. The heavy wall squeaked as it slid on its rails. Efterpi walked inside the house, pushed the glass door, this time from the inside from right to left and dropped her bag on the table. At that moment, she saw me sitting on the bench behind the trees, threw her arms in the air, jumped up and down behind the glass and yelled, but I couldn’t hear her voice. Then she pushed again her glass door from left to right, the glass squeaked and before it was fully open her cat Badi jumped from the chair and came to the door. As Efterpi and I embraced, Badi positioned herself between our feet. I put my travel bag on the floor. Immediately Badi lay on top of it. Efterpi said, ‘Badi is claiming you.’
Without sitting down, I told Efterpi about Besson and that I would be working with him on The Caucasian Chalk Circle for the Festival d’Avignon, and that I had to learn French. ‘I’ll help you,’ said Efterpi.
On the wall behind Efterpi hung a cloth like those the old street photographers of Istanbul would hang as a background to photograph people in front of them. ‘Istanbul Hatırası—Memories of Istanbul’ was embroidered on the cloth.
‘Did you get this in Istanbul?’
‘Yes, I bought it from a street photographer. Zavallı adam—poor man, he wanted to sell me his tripod camera too. He said, ‘Polaroid arrived and killed my three-legged friend, hanım.’ He was wearing a yellow cotton jacket that was too small for him. I photographed him in front of his cloth, ‘look.’
She showed me a black and white photo; the photographer’s yellow cotton jacket was black on it. Efterpi said, ‘I’ll run and get a fresh baguette.’ She pushed the glass door again; the glass slid on its steel rails. Badi went out first, then Efterpi. From the garden, Efterpi pushed the glass door again; the glass rolled and squeaked on the steel rails.
I stood still in the middle of the room with the black and white photograph of the Istanbul street photographer; instead of looking at his face, I stared at his jacket. It had three pockets. If you were to empty them, out would fall loneliness. Or perhaps a piece of faded paper on which would be written:
The road was lonely, animals and we too
We looked around — in disbelief
All around us, night. [1]
The street photographer stood by a wall, holding his tripod in his left hand. The embroidered ‘Memories of Istanbul’ cloth was still hanging behind him, next to it, someone had written in chalk:
Hey, old sunbird
Give me my memories
So I can recognize myself, maybe. [2]
I knew this wall in front of which Efterpi had photographed the street photographer. It was the wall of the British Consulate in Istanbul. Twenty-five years later al-Qaeda suicide bombers would plough into it with a van, killing themselves; the British consul who spoke Turkish loved Istanbul, and wanted to spend all his life there; the tea server and other people who worked in the consulate. The father of one of the victims tried to find a piece of his child among the glass fragments—searching, searching but only finding pieces of glass.
Badi scratched at the glass door from outside, wanting to get in. I pushed the glass door to the right, the rails squeaked, Badi came in and sat on my bag again. I pushed the glass door back to the left, it screeched. On one of the walls hung two enlarged photos. A woman and a man. These were Efterpi’s parents. Efterpi had shown me the tiny pictures in Istanbul. Her mother and father were murdered in Thessaloniki during the Nazi occupation of Greece in the 40s. Efterpi’s mother was a Sephardic Jew, her father Greek. Efterpi was two years old when her father and her mother were killed only a day apart. Efterpi was then sent to Istanbul, to her fraternal aunt who was married to an Istanbul Greek. Efterpi grew up in Istanbul. Her aunt’s husband kept books by Marx in his library. When one night, in 1955, nationalist Turks smashed the shops, churches and graveyards of the Istanbul Greeks and Jews, Efterpi’s aunt and uncle emigrated with her to Greece. Efterpi returned to Istanbul at 18 and married an Istanbul Greek—Charis; then moved to Paris with him.
When we were in Istanbul, Efterpi told me the only thing she had from her parents were the two small photos. Every year she took the two photos out of an envelope that her father had received in the 40s. Although she knew they were dead, she hoped or rather wanted to discover her father and mother gradually ageing on these photos, and to think they live on, they live on.
We said back then, in Istanbul, that she should enlarge these two small photos and hang them on the wall where they could yellow, and she could at least see the photos age. In one of the photos was Efterpi’s father—hands on hips; wearing a white shirt tucked into his trousers, standing on stony ground. His diagonally striped tie waving to the left in the wind. In the right corner of his mouth, a black cigar. His lower lip protruded a little to hold it in place. The photograph of Efterpi’s mother was a passport photo. She was looking ahead, mouth closed, eyes fixed on the photographer, who had probably just lifted the black cloth to duck under and take the shot. He would come out straight away and adjust the lens cap, exposing the gelatine plate with a rhythmic, elegant movement
Efterpi told me, back then in Istanbul, that she didn’t want children, because if something were to happen to her, she didn’t want her child to grow up motherless and suffer as she had.
***
TELEFONZELLE
Benno sagte: »Hallo, oui.« »Ich bin da, Herr Besson.« »Willkommen, ich freue mich. Komm um drei Uhr zu mir.« Ich notierte seine Adresse. Dann rief ich meine armenische Freundin Mari aus der Schauspielschule an, die Istanbul mit meiner anderen Freundin Diana nach dem Militärputsch verlassen hatte. Ein Mann sagte: »Alo oui.« »Mari?« Der Mann fing an, türkisch zu sprechen, sagte: »Mari lebt nicht mehr in Paris.« »A, a.« »Sie hat vor zwei Monaten jemanden kennengelernt, sie ist mit ihm nach Kanada. Ich wohne jetzt hier.« »Ach«, sagte ich, »sie war in Istanbul meine beste Freundin. O, o, bin ich zu spät gekommen, o, o, o, o, o?« Dann schwieg ich. Der Mann am Telefon schwieg auch. Und irgendwann sagte ich: »Ach, ach, ach.«
Der Mann draußen vor der Telefonzelle wartete. Er wackelte mit seinem Kopf vor der Scheibe, lächelte und zeigte mir seinen Telefon-Jeton. »Ich muss auflegen.« Der Mann am Telefon sagte: »Ich heiße Sinan, wohne am Boulevard Raspail, kommen Sie irgendwann vorbei, dann sehen Sie, wo Mari gewohnt hat.«
Ich ging aus der Telefonzelle, aber blieb davor stehen.
Dich zog es also nach Kanada, Mari. Nein, falsch. Jemand, ein Mensch, zog sie nach Kanada. Sie war in Paris, also in einer Stadt, in Frankreich, in einem Land, aber dann ist sie hinter einem Menschen hergegangen, so wie ich zuerst nach Berlin ging, nach Deutschland, zu Besson, zu einem großen Theatermann. Besson ging weg von Berlin, sagte, komm mit mir, arbeite mit mir in Paris, und ich ging von Berlin weg. Also, Mari und ich hatten kein Land mehr, sondern einen Menschen. Die Menschen, hinter denen wir hergingen, waren unsere Länder.
Und was wäre, wenn Besson heute stirbt? Dann wäre das Land weg, die Stadt wäre weg, Gare du Nord wäre nicht mehr dein Bahnhof. Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Dann werden nur manche besonderen Menschen dein Land. Dann müsste unsereins auf die Frage, die man öfter hört, »wo leben Sie, leben Sie in Deutschland, leben Sie in Frankreich?«, nicht so antworten: »Ja, ich lebe in Frankreich, ja, ich lebe in Deutschland.« Die richtige Antwort wäre: »Ich lebe in Besson, ich wohne in Besson.« Aber man kann so nicht antworten, weil keiner die richtige Frage stellen wird: »Leben Sie in Besson, wohnen Sie in Besson?«
Was ist aber, wenn es Besson nicht mehr gibt? Wo lebe ich dann, wo ist mein Land?
Der Mann, dem am Seidenhemd ein Knopf fehlte, kam aus der Telefonzelle heraus, sprach auf Französisch, sagte ein paar Mal: »Occupé, occupé.« Wahrscheinlich meinte er, es sei besetzt, ich könne jetzt telefonieren, und er lächelte wieder.
Ich wohne in einem Lächeln.
Gut, mein Land ist sein Lächeln.
Merci, Monsieur.
Er ging weg, ging in die Richtung, in die Gaspard und Maurice gegangen waren. Ich übte mein erstes französisches Wort, occupé, und notierte in der Telefonzelle oküpe in mein Heft und die Adresse, wo Mari gewohnt hatte. Dann ging ich raus, blieb aber vor der Telefonzelle stehen. Eine Frau kam, stand vor mir, schaute mich fragend an. Ich sagte: »Nümero oküpe.« Sie ging in die Zelle, telefonierte, kam heraus, sagte im Vorbeilaufen: »Madame!« Ich ging wieder in die Telefonzelle hinein, und ohne einen Jeton einzuwerfen, nahm ich den Hörer ab, lehnte mich an das Fenster und sprach mit mir.
»Madamm weiß nicht, wo sie heute Nacht schlafen wird. Madamm hat kein Geld, Madamm hat kein Land, sondern nur einen Menschen, dafür braucht Madamm keine Aufenthaltserlaubnis, aber wenn ein Polizist ihren Pass verlangt und ihn anschaut, wird er fragen: ›Aber Madamm, wo ist ihre Aufenthaltserlaubnis? Sie leben in Europa schwarz, Sie befinden sich hier schwarz, Sie müssen zurück in Ihr Land. Seit drei Jahren leben Sie schwarz in Europa, Sie dürfen aber als Tourist nur drei Monate bleiben.Wo haben Sie drei Jahre lang gelebt, Madamm?‹ ›In Berlin.‹ ›Was haben Sie da gemacht?‹ ›Am Theater gearbeitet.‹ ›Und wo ist Ihre Arbeitserlaubnis?‹ ›Ich habe in Ostberlin gearbeitet, das Internationale Theaterinstitut hat mir für die Zeit ein Papier, eine Art Visum, eine Art Arbeitserlaubnis, gegeben.‹ ›Und wo ist es, dieses Papier?‹ ›Als ich von Ostberlin wegging, haben sie es mir an der Grenze wieder abgenommen.‹ ›Können Sie es beweisen?‹ ›Ich weiß es nicht.‹ ›Wo wohnen Sie hier in Paris?‹ ›Ich weiß es nicht. In der Telefonzelle?‹ ›Kommen Sie mit!‹ ›Nein, ich muss hier in der Telefonzelle bleiben.‹ ›Warum, Madamm?‹ ›Ja, weil die Ausländer telefonieren gerne, und wenn sie mit ihren Ländern telefonieren, schreien sie in den Hörer. Istanbul ist weit weg von hier.‹ ›Sie sind aus Istanbul, Madamm?‹ ›Ja, aus Istanbul.‹ ›Madamm, als ihr eure Revolution mit Atatürk gegen eure Sultane machtet, habt ihr eure Sultane geköpft?‹ ›Nein, wir haben sie nicht geköpft.‹ ›Nicht mal sie ins Gefängnis gesteckt, Madamm?‹ ›Nein, nicht mal ins Gefängnis. Sie stiegen in ein Schiff und verließen Istanbul.‹ ›Das ist gut, Madamm. Sie haben es gut gemacht. Wir Franzosen haben unsere Könige und Königinnen geköpft. Wir haben ein Trauma, Madamm. Auf Wiedersehen, Madamm.‹«
Ich glaube, ich hatte den Hörer zu fest angefasst, mein Handgelenk tat mir weh und meine Reisetasche war müde, sie hing schief an meiner Schulter herunter. Ich schlug das Pariser Telefonbuch auf, suchte die Adresse von Efterpi und Charis und fand sie: Rue de la Glacière, 13. Arondissement, Paris.
EFTERPI DE LA GLACIÈRE
An der Rue de la Glacière ging ich in ein neueres Hochhaus rein. Die spanische Portiersfrau zeigte mir den Weg durch einen dunklen Korridor in den Garten. Der Garten war groß, und auf der linken Seite standen vier gleich aussehende Studios nebeneinander. Die Wände zum Garten aus dickem schwerem Glas, die man zur Seite schieben konnte, waren gleichzeitig die Türen, durch die man in die Räume hineinsehen konnte. Die Portiersfrau blieb vor dem dritten Studio stehen, sagte: »Voilà Madame.«
Als ich vor der Glastür von Efterpi stand und in den Raum hineinschauen wollte, sah ich im Glas zuerst nur meinen Schatten, und durch meinen sich bewegenden Schatten sah ich nicht, was hinter dem Glas war. Ich ging näher an den Schatten heran, bis meine Nase an dem Glas klebte, sodass ich meinen Schatten nicht mehr sah, erst dann sah ich den hohen großen Raum. Ganz vorne standen ein langer Tisch und Stühle, auf dem Tisch lagen ein Baguette und Baguettekrümel und ein Buch, Georges Sadoul, Dictionnaire des filmes, eine Zigarettenschachtel, hinter dem Tisch stand ein querstehendes Sofa und auf dem Boden zwei grüne Halbschuhe mit hohen Absätzen, in der Mitte des Zimmers noch mal zwei kleine Tische, auf denen Papiere, Bücher und eine Schreibmaschine lagen. Hinten war ein großes Bett auf dem Boden, mit Teppichen und Kissen bedeckt, neben einem Kamin. Nach links ging eine Treppe hoch, und an der ganzen rechten Wand war ein hohes Regal, aus dem unzählige Bücher und Schallplatten von ihren Plätzen aus auf das schattige Zimmer in eine lebendige Ruhe hineinschauten. Wie man am Baguette und den Krümeln die Hände der Menschen, die das gegessen hatten, sehen konnte, sah man an den Büchern die Hände, die sie aufgeschlagen, gelesen, zugemacht, hingestellt, dann wieder heruntergenommen, hineingeschaut, benutzt, wieder zugemacht hatten, sie standen auf ihren Plätzen weiter hinten, weiter vorne, etwas krumm gestellt, so als ob sie mit ihren Stimmen in diesem Raum ein ständiges Echo auslösten. Das Licht wuchs vom Garten in diesen großen Raum auf den Steinboden. Die Bilder an den Wänden, die Bücher, die Beine von Stühlen, Tischen spiegelten sich in diesem wachsenden Licht, und auf dem langen Tisch hinter der Glaswand spiegelte sich neben dem Baguette und den Krümeln der Birkenbaum aus dem Garten. Sein Schattenbild zitterte auf dem Tisch, weil seine Blätter sich draußen mit dem leichten Wind bewegten. Ich fasste den Birkenbaum, rüttelte etwas, sein Schattenbild zitterte auf dem Tisch jetzt noch schneller.
Plötzlich kam eine Katze, die krumme Beine hatte, die Treppe herunter, lief über den Schatten auf dem Boden, kam bis nach vorne, sprang hoch auf einen Stuhl, der in den Garten schaute, setzte sich auf das dicke Kissen, von dem ein paar Katzenhaare in die Luft flogen, und guckte in meine Richtung. Das war Badi. Efterpi hatte mir damals ein Foto von ihr nach Istanbul geschickt.
Efterpi und ich kannten uns aus Istanbul. Das war Ende der Sechziger, vor dem zweiten Militärputsch. Mein Freund, der in Italien bei Pasolini und Fellini Film studiert hatte, gründete damals in Istanbul eine Cinemabewegung. Wir gaben eine Zeitschrift heraus wie Cahiers du cinéma, in der wir Filme von Godard, Buñuel, Pasolini, Glauber Rocha, Brecht, Ousmane Sembène, Dziga Vertov, Jean-Marie Straub, Eisenstein analysierten. Und als mein Freund seinen ersten Film über einen Widerständler namens Blindensohn aus dem Osmanischen Reich drehen wollte und das bisschen Geld, das er hatte, nur für das Filmmaterial ausgeben konnte, brauchte er Menschen, die gratis für diesen Film arbeiteten. Bald hatte er diese Gruppe. Sie bestand aus vier türkischen Griechen, einem türkischen Juden und sechs Türken, darunter große Theaterstars. Efterpi und Dido aus der Gruppe waren Istanbuler Griechen. Efterpi war verheiratet mit Didos Bruder Charis, der in Paris an der Uni als Dokumentarfilmprofessor arbeitete. Dido war Skriptgirl. Wir brauchten für unseren Film jemanden, der eine Blindenmaske herstellen konnte, weil der Widerständler Blindensohn, um den es in dem Film ging, einen Vater hatte, den der böse Feudalherr mit heißen Spießen blenden ließ. Efterpi lernte in Paris monatelang Maskenbildnerin und kam nach Istanbul und hatte eine sehr gute Maske für den Schauspieler, der den Blinden spielte.
Ich wohnte mit meinem Freund in einem Wald. Als Efterpi nach Istanbul kam, gingen wir alle im Wald spazieren. Efterpi war so schön, sogar die Schäferhunde, die vor unserem Waldhaus jeden Fremden, der vorbeikam, kräftig anbellten, vergaßen zu bellen. Als wir in der Gruppe spazierten, ging Efterpi irgendwann im Wald verloren. Wir riefen nach ihr, suchten nach ihr. Mein Freund lachte und sagte: »Pariser Frauen gehen gerne verloren, damit man nach ihnen sucht.« Dass Pariserinnen sich gerne suchen ließen, gefiel mir. Mein Freund hatte ähnlich wie Eisenstein sein gesamtes Szenario gezeichnet. Bild für Bild. Am ersten Drehtag, alle glücklich, auch die Sonne oben, drehten wir auf einem Grundstück, auf dem es einen Pferdestall gab. Der Widerständler Blindensohn hatte ein legendäres Pferd. Meine Aufgabe bei dem Film war Kameraassistentin, und ich hatte die schönste Frauenrolle: Ich war die Geliebte des Widerständlers Blindensohn, und man würde mich in der Mitte des Films an meinen Haaren an die Äste hängen und töten. Ich hatte Haare bis zur Hüfte.
Wir drehten zuerst die Waffenhändlerszene,Waffenhändler aus Europa, die dem bösen Feudalherrn Waffen lieferten, um den Blindensohn zu töten. Dann drehten wir im Pferdestall. Ein Zigeuner hatte uns sein weißes Pferd als begabten Pferdedarsteller gebracht. Das Pferd spielte Blindensohns Pferd. Mein Freund zeigte die Zeichnung dieser Szene dem Beleuchter. Das Licht in der Szene sollte nur auf dem Rücken dieses Pferdes eine lange Linie zeichnen. Sonst musste alles dunkel sein. Das klappte nicht. Der Beleuchter holte den berühmtesten Beleuchter der Istanbuler Filmindustrie, ein älterer Herr mit einer dunklen Brille. Das Pferd wartete artig im Stall. Aber dieses Licht, das nur auf dem Rücken dieses Pferdes eine lange Linie zeichnen sollte, klappte auch mit ihm nicht. Es gingen ein paar Stunden vorbei. Draußen wurde es langsam dunkel, und der Zigeuner sagte, er muss mit dem Pferd jetzt nach Hause. Er und das Pferd gingen. Der jüdische Mitarbeiter Jakob fuhr den Starbeleuchter in die Stadt, mein Freund, Efterpi, Dido und Yorgo fuhren mit dem Filmmaterial, das wir schon gedreht hatten, in einem Taxi nach Hause zu Yorgo und vergaßen alle Filmkassetten im Kofferraum des Taxis. Ich fuhr mit dem Kameramann zu seinem Büro im Hurenviertel von Istanbul, um dort die Arriflex–mm-Kamera im Schrank einzuschließen. Einige Huren begrüßten uns und fragten den Kameramann, was wir heute gedreht hätten, wie der Film heiße. Er sagte lachend: »Pferdelicht – AT IŞIĞI.«
Der Film kam nie zustande. Das Geld fehlte, und bald kam der Militärputsch 1971, und der griechische Partner meines Freundes,Yorgo, haute nach Athen ab, weil er ein Marxist war und vor dem türkischen Militär Angst hatte. Efterpi kehrte nach Paris zurück. In Istanbul traf sie auf einer steilen Gasse eine Katze, die krumme Beine hatte, nahm sie mit nach Paris und gab ihr den Namen Badi – die Krumme.
Ich klopfte an das Glas, rief: »Efterpi, Efterpi!«, schaute in Richtung der Treppe, als ob sie, wie die Katze Badi, plötzlich dastehen könnte. Nichts bewegte sich.
Im Glas irgendwo hinter mir spiegelte sich vor einer hohen Gartenmauer eine Sitzbank. Ich lief zwischen den Pflanzen und Bäumen durch den Garten zu dieser Bank, setzte mich hin.Von der Sitzbank aus sah ich durch die Glaswände in alle vier Studios. In dem Studio neben Efterpis sah ich auch eine Katze. Sie stand auf einem hohen Podest wie eine Statue und schaute wie Badi in Richtung Garten. Der Garten war ruhig, nur in der Ferne hörte ich Schreibmaschinengeräusche. Sie kamen aus dem Fenster einer der Wohnungen in dem Hochhaus, deren Rückfenster in den Garten schauten.
Ich legte mich auf die Gartenbank, schloss die Augen, dachte an den Zugkorridor zwischen Berlin und Paris. Das Café am Gare du Nord. Gaspard und Maurice. Telefonzelle. Den Mann, dem ein Hemdknopf fehlte. Gartenbank. Ich beschäftigte mich, Augen zu, mit dem fehlenden Hemdknopf des Mannes in der Telefonzelle, und der schwarze Hörer in der Kabine war durch das viele Benutzen etwas abgestumpft, und in dem Telefonbuch, das ich aufgeschlagen hatte, fehlten manche Seiten, und die gelbe Wildlederjacke des blinden Gaspard hatte einen Wollkragen.
Als ich auf der Bank, Augen zu, lag, flog ab und zu ein Vogel über mich, machte tcik, setzte sich sicher auf einen Baum oder ein Gebüsch, machte auch dort ein Tcik.
Tcik
Tcik
Tcik
Tcik.
Zwischen den Tciks hörte ich das mechanische Geräusch einer schwer aufgehenden Tür. Efterpi schob gerade ihre Glaswand von rechts nach links, die schwere Glaswand fuhr quietschend auf einer Schiene. Efterpi ging ins Haus hinein, schob die Glaswand, diesmal von innen, von rechts nach links, stellte ihre Tasche auf den Tisch. In diesem Moment sah sie mich auf der Gartenbank hinter den Bäumen, hob ihre Arme hoch, sprang hinter dem Glas hoch und runter, schrie, aber ich hörte ihre Stimme nicht. Dann schob sie ihre Glaswand wieder von links nach rechts, das Glas quietschte, und bevor die Glastür ganz aufging, sprang ihre Katze Badi schnell von ihrem Stuhl und kam zur Tür. Als Efterpi und ich uns umarmten, stand Badi zwischen unseren Füßen. Ich legte meine Reisetasche auf den Boden. Badi legte sich sofort über sie. Efterpi sagte: »Badi nimmt dich in Besitz.«
Im Stehen erzählte ich Efterpi von Besson und dass ich mit ihm für den Kaukasischen Kreidekreis für das Festival d’Avignon arbeiten würde, dass ich Französisch lernen müsse. Efterpi sagte: »Ich helfe dir.«
Hinter Efterpi hing an der Wand ein Tuch, so eines, wie die alten Straßenfotografen von Istanbul als Hintergrund an eine Mauer hängten, um die Menschen davor zu fotografieren. Auf diesem Tuch war der Satz gestickt: »Istanbul Hatırası – Istanbuler Erinnerung.«
»Hast du das Tuch aus Istanbul?«
»Ja, ich habe es von einem Straßenfotografen gekauft. Zavallı adam – armer Mann, wollte mir auch seine dreibeinige Stativkamera verkaufen. Er sagte: ›Polaroid ist gekommen, hat mir meine Dreibeinige getötet, hanım.‹ Er trug eine gelbe Stoffjacke, die ihm zu klein war, ich habe ihn noch vor seinem Tuch fotografiert, schau her.«
Sie zeigte mir ein Schwarz-Weiß-Foto, die gelbe Stoffjacke des Fotografen war dort schwarz. Efterpi sagte: »Ich hol schnell ein frisches Baguette.« Sie schob die Glastür wieder zur Seite, das Glas fuhr durch die Schiene aus Stahl. Zuerst ging Badi hinaus, dann Efterpi.Vom Garten aus schob Efterpi die Glastür wieder zurück, das Glas fuhr durch die Schiene aus Stahl und quietschte.
Ich blieb mit dem Schwarz-Weiß-Foto des Istanbuler Straßenfotografen in der Mitte vom Raum stehen, schaute mir anstatt seines Gesichts nur seine Jacke an. Diese Jacke hatte drei Taschen. Wenn man die umdrehen würde, fiele aus jeder Tasche Einsamkeit. Oder vielleicht ein gefaltetes Papier, auf dem geschrieben steht:
Der Weg war einsam, Tiere und auch wir
wir schauten – unglaublich
jede Seite um uns, Nacht
Der Straßenfotograf stand vor einer Mauer, hielt mit seiner linken Hand die langen drei Beine seiner Stativkamera. Das bestickte Istanbuler Erinnerungstuch hing noch hinter ihm, neben dem Tuch hatte jemand mit Kreide drei Sätze an die Mauer geschrieben:
Ey, alter Sonnenvogel
Gib mir meine Erinnerungen
Ich kann mich dann erkennen, vielleicht
Diese Mauer, vor der Efterpi den Straßenfotografen fotografiert hatte, kannte ich. Es war die Mauer des Istanbuler britischen Konsulats. Fünfundzwanzig Jahre später werden die Al-Qaida-Anhänger mit einem Auto da reinfahren, sich selbst, den britischen Konsul, der Türkisch konnte und Istanbul sehr liebte und nur noch da leben wollte, den Teemann und andere Menschen, die im Konsulat arbeiteten, mit Bomben töten. Der Vater eines Getöteten wird ein Stück seines Kindes zwischen den Glassplittern mit seinen Händen finden wollen, suchen, suchen, aber nur Glassplitter anfassen.
Badi kratzte draußen im Garten an die Glastür, wollte herein. Ich schob die Glastür nach rechts, die Schienen quietschten, Badi kam rein, setzte sich wieder auf meine Reisetasche. Ich schob die Glastür wieder nach links, sie quietschte. An einer der Wände hingen zwei von kleinen Bildern vergrößerte Fotos. Eine Frau und ein Mann. Es waren Efterpis Mutter und Vater. Efterpi hatte mir die kleinen Bilder in Istanbul gezeigt. Ihre Mutter und ihr Vater waren in den Vierzigerjahren in Thessaloniki, als die Nazis in Griechenland waren, von denen getötet worden. Efterpis Mutter war eine sephardische Jüdin, ihr Vater Grieche. Efterpi war zwei Jahre alt, als ihr Vater und ihre Mutter mit einem Tag Unterschied getötet wurden. Efterpi wurde dann nach Istanbul zu der Schwester ihres Vaters gebracht, die mit einem Istanbuler Griechen verheiratet war. Efterpi wuchs in Istanbul auf. Der Ehemann ihrer Tante hatte in seiner Bibliothek Bücher von Marx. Als in einer Nacht 1955 nationalistische Türken die Läden, die Kirchen, die Friedhöfe der Istanbuler Griechen und Juden zertrümmerten, emigrierten Efterpis Tante und Onkel mit ihr nach Griechenland. Mit 18 ging Efterpi nach Istanbul zurück, heiratete einen Istanbuler Griechen, Charis, kam mit ihm dann nach Paris.
Efterpi hatte mir in Istanbul erzählt, dass es von ihren Eltern nur die zwei kleinen Fotos gab. Sie holte jedes Jahr diese zwei Fotos aus einem Briefumschlag, der in den Vierzigerjahren an ihren Vater geschickt worden war. Obwohl sie wusste, dass sie tot waren, hoffte oder wollte sie Jahr um Jahr das allmähliche Älterwerden ihres toten Vaters und ihrer toten Mutter auf diesen Fotos entdecken und denken, sie leben weiter, sie leben weiter.
Wir sprachen damals in Istanbul darüber, dass sie diese zwei kleinen Fotos vergrößern und an die Wand hängen sollte, um sie dort vergilben zu lassen, um wenigstens das Älterwerden dieser Fotos zu sehen. Auf dem einen Foto stand Efterpis Vater, die Hände auf seiner Hüfte, mit einem weißen Hemd, das in die Hose gesteckt war, auf einem steinigen Boden. Seine Krawatte, schräg gestreift, flog durch den Wind, der gerade wehte, nach links. In seinem rechten Mundwinkel eine schwarze Zigarre. Er musste die Unterlippe ein bisschen vorschieben, um sie festzuhalten. Das Foto von Efterpis Mutter war ein Passbild. Sie schaute, Mund zu, Augen auf, zu dem Fotografen, der wahrscheinlich gerade das schwarze Tuch hochhob, um unter das Tuch zu gehen und die Einstellung vorzunehmen: Gleich wird er wieder rauskommen und den Objektivdeckel von der Kamera mit einer rhythmischen, eleganten Bewegung abnehmen und die Gelatineplatte während dieser rhythmischen Bewegung belichten.
Efterpi hatte mir in Istanbul gesagt, dass sie kein Kind haben will, weil, wenn ihr was passierte, wollte sie nicht, dass ihr Kind unter Mutterlosigkeit genauso leidet wie sie.
Emine Sevgi Özdamar grew up in Istanbul, where she attended drama school. In the mid-seventies, she moved to Berlin and Paris and worked with directors Benno Besson, Matthias Langhoff, and Claus Peymann, among others. She appeared in several films and has been writing plays, novels, and short stories since 1982. She has received numerous awards for her work, including the Ingeborg Bachmann Prize in 1991 and the Kleist Prize in 2004. Emine Sevgi Özdamar lives in Berlin. Ein von Schatten begrenzter Raum [A Space bounded by Shadows] can be considered to be the sum of her artistic work to date.
Yana Ellis is a Bulgarian-born freelance translator working from German and Bulgarian into English. She holds an MA in Translation from the University of Bristol. Yana is drawn to narratives that explore issues of identity, immigration, and the representation of the “other.” Her translations have been published in No man’s Land journal. She was chosen as one of the American Literary Translators’ Association (ALTA) Virtual Travel Fellows for 2022 and her work was shortlisted for the 2022 John Dryden Translation Competition.
[1] Turgut Uyar, ‘Güz Avlanıp Gidiyor’.
[2] Turgut Uyar, ‘Ey yaşlı güneş kuşu’